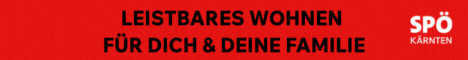Pressemeldungen Februar 2023
Pressemeldungen Februar 2023  Landhaus in Klagenfurt seit über 440 Jahren politisches Zentrum des Landes
Landhaus in Klagenfurt seit über 440 Jahren politisches Zentrum des Landes
Landhaus in Klagenfurt seit über 440 Jahren politisches Zentrum des Landes
Spannende Geschichten rund um den Kärntner Landtag. Geschichtsvereins-Direktor Wilhelm Wadl berichtet über Klagenfurter Landhaus, Revolution von 1848, allgemeines Wahlrecht und erstmals ausgeübtes Frauenwahlrecht, Ausschaltung und Wiederherstellung der Demokratie.
Wussten Sie, dass das Landhaus in Klagenfurt seit über 440 Jahren politisches Zentrum des Landes Kärnten ist? Wussten Sie, dass die Gesetzgebungsperioden des Kärntner Landesparlaments von 1861 weg bis heute gezählt werden? – Die neue Periode nach den Wahlen vom 5. März 2023 wird demnach die 33. sein. Haben Sie gewusst, dass am 19. Juli 1921 erstmals auch Frauen bei einer Landtagswahl in Kärnten mitstimmen durften? Kennen Sie Dora Kircher? – Die Villacherin war die erste gewählte Abgeordnete im Kärntner Landtag, wirkte dort von 1921 bis 1934. Und Karin Achatz? – Die Klagenfurterin wurde 1990 das erste weibliche Regierungsmitglied in Kärnten. Wilhelm Wadl, der Direktor des Geschichtsvereines für Kärnten, hat diese und weitere spannende Fakten rund um Landtagswahlen in Kärnten zusammengestellt.
„Landtage gibt es in Kärnten schon seit dem 15. Jahrhundert. Ursprünglich hatten sie aber keinen festen Sitz. Sie wurden vom Landesfürsten zur Beratung dringender Angelegenheiten in verschiedenen Städten wie Völkermarkt, St. Veit oder Friesach einberufen“, erklärt Wadl. Im Klagenfurter Landhaus wurde erstmals am 4. Dezember 1581 ein Landtag der Kärntner Landstände abgehalten. In den folgenden über 440 Jahren gab es laut Wadl nur zwei kurze Phasen ohne Sitzungen im Landhaus: „Im Juni 1919 flohen Landtag und Landesregierung nach dem Vorstoß südslawischer Truppen über Villach nach Spittal, übersiedelten dann bis nach der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 nach St. Veit“, so der Direktor des Geschichtsvereines. Die zweite Phase dauerte von der konstituierenden Sitzung des ersten Nachkriegslandtages am 10. Dezember 1945 bis zum 22. Juli 1948, weil die britische Militärregierung das Landhaus für sich beansprucht hatte.
Nicht gewählte Landtagsmitglieder
„Bis 1848 wurden die Mitglieder des alten ständischen Landtages nicht gewählt. Sitz und Stimme hatten damals Adelige, Bischöfe, Äbte, Pröbste, bürgerliche Städte und Märkte“, so Wadl. Im Revolutionsjahr 1848 fanden in Kärnten erstmals Wahlen im modernen Sinn statt. Sie waren laut dem Historiker aber noch weit davon entfernt, auf einem allgemeinen und gleichen Wahlrecht zu basieren. 1861 wurden für jedes Kronland eine eigene Landesordnung und eine Landtagswahlordnung publiziert, letztere schloss aber weiterhin den größten Teil der Bevölkerung vom Wahlrecht aus.
„Erst 73 Jahre nach der bürgerlichen Revolution von 1848 kam es zur Durchsetzung demokratischer Prinzipien“, sagt Wadl. Die ersten Kärntner Landtagswahlen unter Einhaltung eines allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts für alle erwachsenen Bürgerinnen und Bürger fand am 19. Juni 1921 statt. Davor, nach dem Ersten Weltkrieg, hatte ab November 1918 eine provisorische Landesversammlung auf Basis der Reichsratswahl von 1911 getagt. Sie wählte den Großgrundbesitzer Arthur Lemisch zum Landesverweser. „Dieses Provisorium hielt ganze zweieinhalb Jahre an“, betont Wadl. Grund für die späten Landtagswahlen waren die jahrelangen Auseinandersetzungen um die Kärntner Landesgrenzen.
Allgemeines Wahlrecht und Frauenwahlrecht
„Sowohl im Kärntner Landtag, als auch in der Landesregierung gab es 1921 keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Nach zähen Verhandlungen ermöglichten die bürgerlichen Parteien schließlich die Wahl des aus Schlesien stammenden Sozialdemokraten Florian Gröger zum Landeshauptmann“, sagt der Geschichtsvereins-Direktor.
Auf Skepsis bei vielen politischen Vertretern stieß 1921 das erstmals bei einer Kärntner Landtagswahl geltende Frauenstimmrecht. „Durch die tausenden Kriegstoten gab es eine deutliche weibliche Wählermehrheit. Dies wurde durch die etwas geringere Wahlbeteiligung von Frauen teilweise ausgeglichen“, erklärt Wadl. Wie Frauen in der Ersten Republik in Kärnten wählten, ist übrigens leicht herauszufinden: „Ihre Stimmen wurden getrennt von den Männerstimmen gezählt“, berichtet Wadl. Die Christlichsozialen und die gleichfalls katholisch orientierte Partei der Kärntner Slowenen wiesen einen markanten Überhang an Frauenstimmen auf. Beim Landbund war das Geschlechterverhältnis fast ausgeglichen. Der Heimatblock (=Heimwehrpartei) und die Sozialdemokraten waren in ihrer Wählerschaft leicht „männerlastig“, die rechts- und linksextremen Parteien wurden eindeutig von Männern bevorzugt.
„Die Wählerschaft war mehrheitlich weiblich, in den Parlamenten jedoch saßen noch jahrzehntelang fast nur Männer“, so Wadl weiter. In der provisorischen Landesversammlung ab 11. November 1918 gab es mit Anna Gröger nur eine Frau. Sie wurde noch vor der Einführung des Frauenstimmrechts berufen und war eine der ersten weiblichen Abgeordneten Österreichs. Die erste gewählte Abgeordnete im Kärntner Landtag war die Villacher „Eisenbahnergattin“ Dora Kircher. „Sie blieb die einzige weibliche Abgeordnete in der Ersten Republik. Auch nach 1945 war der Frauenanteil im Landtag noch lange Zeit sehr niedrig“, sagt der Geschichtsvereinsdirektor. Noch viel länger dauerte es, bis Frauen in Regierungsgremien einzogen. Erste Ministerin auf Bundesebene war 1966 die Wienerin Grete Rehor in der Regierung Klaus. 1990 gab es mit Karin Achatz erstmals ein weibliches Regierungsmitglied in Kärnten.
Ende und Wiederherstellung der Demokratie
Wadl geht auch auf die dunklen Zeiten ein, in denen die Demokratie ausgeschaltet wurde. Im Ständestaat wurde die Demokratie in Österreich auf Bundesebene im März 1933 beseitigt. „Der Kärntner Landtag tagte hingegen noch bis zum Februar 1934. Erst durch den Ausschluss der sozialdemokratischen Abgeordneten wurde er zu einem Rumpfparlament ohne demokratische Legitimität. Seine Abgeordneten wurden nicht gewählt, sondern von der Regierung ernannt“, so der Direktor. In der NS-Zeit gab es in den Reichsgauen nicht einmal ein Scheinparlament. „Ins Landhaus zog damals auf Basis eines Scheinpachtvertrages die Gauleitung der NSDAP ein“, sagt Wadl. Die Wiederherstellung der Demokratie erfolgte in Kärnten am 7. Mai 1945 mit der Konstituierung einer provisorischen Landesregierung noch vor dem Eintreffen alliierter Streitkräfte. „Die 17 Landtagsperioden seit 1945 sind geprägt von fast acht Jahrzehnten ununterbrochener demokratischer Kontinuität. Ihnen stehen nur fünf Landtagsperioden in der Zwischenkriegszeit und zehn in der konstitutionellen Ära der Habsburgermonarchie gegenüber“, betont der Direktor des Geschichtsvereines.
Informationen zum Geschichtsverein unter: https://geschichtsverein.ktn.gv.at/
Foto: Kärntner Landesarchiv