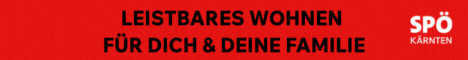„Der Krieg ist das Problem, nicht die Flüchtlinge“
„Der Krieg ist das Problem, nicht die Flüchtlinge“
„Der Krieg ist das Problem, nicht die Flüchtlinge“
Von Bernhard Torsch, 3.8.2015
Alle reden über Flüchtlinge, wir reden diesmal mit ihnen. Wir trafen den Syrer Mohammed und erfuhren einiges über Krieg, Flucht und orientalische Mehlspeisen.
Mohammed ist 26 Jahre alt und stammt aus Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Vor drei Monaten und zwei Wochen rückten die Fronten des Bürgerkriegs immer näher an seine Straße heran. Er entschloss sich zur Flucht. Jetzt verspachtelt er im Garten des Klagenfurter Cafe Fahrnberger einen Nusskuchen und trinkt schwarzen Kaffee mit Zucker. Ich frage ihn, ob die österreichischen Mehlspeisen mit den berühmten arabischen Süßigkeiten mithalten könnten. „Sag nicht arabische Süßigkeiten, sag orientalische“, bittet Mohammed, denn: „Die Christen und Juden in meiner Heimat haben auch tolle Süßwaren“. Bis hierher, in diesen Klagenfurter Gastgarten, hat Mohammed eine verdammt lange und gefährliche Reise hinter sich gebracht. Und er hat Angst, dass sie noch nicht zu Ende sein könnte. Er lebt derzeit im Flüchtlingslager in Krumpendorf, wo er sich erstmals wieder „wie ein Mensch“ fühlt, doch es gibt Gerüchte, man wolle ihn und andere wieder weiter schicken. Ins Unbekannte.
Kämpfen oder fliehen
Mohammed wirkt nicht so, wie man sich einen Flüchtling vielleicht vorstellt. Er ist selbstbewusst, wortgewandt, witzig und schlagfertig. Ein fescher junger Mann, westlich gekleidet, der gerade von einer Vorlesung an der Universität oder aus einem Innenstadtbüro kommen könnte. Erst als ich länger mit ihm rede, merke ich etwas leicht Gehetztes an ihm, eine Unsicherheit, die von Erfahrungen mit Krieg und Diktatur herrührt. Und von einer langen, gefährlichen Flucht, bei der er stets auf der Hut sein musste vor Mördern, Räubern, Organhändlern, Mafiosi und Polizisten. Und wenn er von Damaskus spricht, kriegen seine Augen einen leichten Glanz. Unterdrückte Tränen. Mohammed will nicht weinen. Er ist sehr stolz. Er hat in seiner Heimat Jus studiert, nebenbei gearbeitet und brachte es zu so viel Wohlstand, dass er sich schon in jungen Jahren ein Haus kaufen hatte können. „Es ging mir richtig gut. Ich war jemand, ich wurde respektiert und hatte eine Zukunft“. Er besitzt das Haus immer noch und will dort wieder wohnen, wenn der Krieg vorbei ist. Er rechnet aber nicht damit, dass bald Frieden einkehren wird, denn: „Mir kommt es so vor, als wolle der Westen, dass der Diktator Assad und die Terrorgruppe Islamische Staat ewig so weitermachen können. Sonst würde doch endlich mal einer was dagegen unternehmen“. Er selbst sei vor der Wahl gestanden: Fortgehen oder von einer der Bürgerkriegsparteien zwangsrekrutiert zu werden. Er entschloss sich für die Flucht. „Ich will nicht in einem Krieg kämpfen, der meinem Land von einem Diktator und von ausländischen Kräften aufgezwungen wird“. Als ein 15-jähriger Nachbarsjunge in seiner Straße angeschossen wird und in Mohammeds Armen stirbt, reicht es ihm. Mohammed nimmt seine Ersparnisse, 2.500 Euro, verabschiedet sich von seiner Familie und macht sich auf in Richtung Europa. Er hat keinen Plan, wohin er eigentlich will. Nur weg. Er würde überall bleiben, wo man ihn aufnimmt. Aber schon bald merkt er, dass Flüchtlinge kaum wo willkommen sind.
Zu Gast bei Freunden
Mohammed nippt an seinem Kaffee und lobt Kärnten. So freundlich wie hier sei er nirgendwo aufgenommen worden. Die Hilfsbereitschaft der Kärntner sei überwältigend. Ich denke kurz, dass vielleicht doch was dran ist am Ruf meiner Landsleute, besonders gastfreundlich zu sein, aber Mohammed reißt mich schnell aus meinen Gedanken. „Du verstehst wahrscheinlich nicht, wie das ist. Man hat einen Beruf, man hat ein Haus, man tut nichts Unrechtes. Und plötzlich muss man fliehen und wird in den meisten Ländern wie ein Verbrecher behandelt. Ich bin aber kein Verbrecher, ich bin ein Mensch“. Dann erzählt er wieder von der Flucht. Zuerst überquert er die Grenze zur Türkei und tut sich mit einer kleinen Gruppe zusammen, sechs Männer und zwei Frauen mit kleinen Kindern. Die Türkei ist kein guter Platz für Flüchtlinge. Man will weiter, nach Europa. Warum? „Wir haben immer gedacht, Europa sei ein Ort, wo die Menschenrechte gelten“. So haben sie es in der Schule gelernt. Die Wirklichkeit wird anders aussehen. Einer kennt einen, der ein Boot hat, und die Gruppe setzt an einem stürmischen Frühlingstag nach Griechenland über. Auf halbem Weg gibt der Motor den Geist auf und Wasser dringt ein.
Menschenjäger
Die türkische Küstenwache ignoriert die Notrufe. Erst als man per Funk das Rote Kreuz erreicht und mitteilt, dass das Schiff sinkt, erbarmt sich die griechische Seenotrettung und schleppt den lecken Kahn zur nächst gelegenen Insel, wo man die Flüchtlinge in ein Lager sperren will. Das aber ist überfüllt und so müssen sie acht Tage lang in einem Wäldchen ausharren, ohne jede Versorgung durch die Behörden. Man schickt Mohammed los, um Lebensmittel zu kaufen, weil er gut Englisch spricht und „europäisch“ aussieht. Die Griechen, die gerade selbst mit einer harten Wirtschaftskrise kämpfen, lassen die Flüchtlinge bald weiterreisen. An der mazedonischen Grenze machen Mohammed und seine Leidensgenossen dann Bekanntschaft mit europäischer Nächstenliebe: Polizisten und Bürgerwehren machen mit Gewehren und Knüppeln Jagd auf die Flüchtlinge. Sieben Mal misslingt der Versuch in das Balkanland zu gelangen. Als sie es doch noch schaffen, erwartet sie eine wahre Hölle. Immer nur nachts durchqueren die Syrer das bergige Land. Es regnet oft und überall lauern Gefahren: Fremdenfeindliche Schlägertrupps verprügeln Flüchtlinge, Organhändler lassen Menschen verschwinden um sie auszuweiden, Polizisten würden die Syrer wieder nach Griechenland abschieben, wenn sie sie erwischen. Und dann gibt es noch eine weitere Gefahr – Flüchtlinge aus anderen Staaten, die Syrern die Dokumente stehlen wollen, weil sie wissen, dass man als Syrer recht gute Chancen auf Asyl hat. „Ich bin kein traditioneller Muslim, aber ich habe nie so oft gebetet wie in Mazedonien“, sagt Mohammed. Vielleicht dank dieser Gebete, sicher aber dank einiger Euro an Bestechungsgeld an Polizisten erreicht man schließlich Serbien.
Menschenfreunde und Faschisten
Die zehnköpfige Flüchtlingsgruppe erlebt in Serbien eine Überraschung. „Die Bevölkerung dort war sehr nett zu uns und hat uns sehr geholfen, mit Nahrung, Kleidung und vor allem mit Freundlichkeit“, berichtet Mohammed. In Belgrad habe er erstmals seit langem wieder Menschlichkeit erlebt. Auch die Behörden sind kooperativ und lassen die Syrer nach einer Woche weiterziehen. Hier hake ich ein und frage, ob Mohammed und seine Gruppe einen Führer gehabt hätten, einen Schlepper oder Fluchthelfer. „Nein, wir haben uns per GPS orientiert und sind einfach dorthin gegangen, wo die anderen Flüchtlinge auch hin sind“. Er habe nie einen Schlepper bezahlt, das Geld sei ganz für Nahrung draufgegangen und für SIM-Karten, um die Navigationsfunktion nutzen zu können sowie über Whatsapp mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben. Und dafür, Polizisten zum Wegschauen zu bewegen. „Und dann kam Ungarn“, sagt Mohammed, und er sagt das so, als hätte er statt Ungarn „Hölle“ gemeint. In Ungarn, dessen rechtsgerichtete Regierung gegen Flüchtlinge hetzt und einen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Serbien baut, habe er die schlimmsten Tage der ganzen Flucht erlebt, sagt der junge Syrer. „Die Polizei und uniformierte Faschisten veranstalten dort eine regelrechte Menschenjagd. Vier aus unserer Gruppe, die beiden Frauen samt ihren Kindern, wurden geschnappt. Später habe ich erfahren, dass man sie ins Gefängnis sperrte, wo sie immer noch sitzen. Dort mussten sie sich nackt ausziehen und wurden auch an den intimsten Stellen durchsucht. Eine schlimmere Demütigung ist für Muslime kaum vorstellbar. Ich würde lieber sterben als so was über mich ergehen zu lassen“. Wieder kriegt Mohammed diesen glasigen Blick und er sagt erneut: „Wir sind doch keine Verbrecher“. Die verbliebene Gruppe kämpft sich durch Wälder und über Steppen über das Land. Es ist kalt und stürmisch an diesen Frühlingstagen. „Wir haben dermaßen gefroren und gehungert, dass wir dachten, wir müssten sterben“. Als man die grüne Grenze zu Österreich überquert, wähnt man sich endlich in Sicherheit.
Das paradiesische Wien
„Österreich“, sagt Mohammed und zupft sein Sweatshirt zurecht, „das war für uns Wien, und Wien war Kultur, Zivilisation, Kunst und Musik“. In seiner Heimat gebe es viele Gedichte und Lieder, die Wien als eine Art Paradies preisen, ein multikulturelles Utopia voller Grün, Lebensfreude und Menschenliebe. Mohammed hat Wien nie gesehen. Die Polizei, der man sich stellt, bringt den Flüchtlingstrupp nach Traiskirchen. „Hatten wir von Wien gedacht, es wäre der Himmel, so empfanden wir das Lager Traiskirchen wie das Fegefeuer“. Mohammed gehört zu jenen hunderten Menschen, die im Freien auf dem nackten Boden schlafen müssen – auch bei Regen und bei größter Hitze. Die Verpflegung ist völlig unzureichend, nicht auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt und etliche Pechvögel kommen oft tagelang an gar kein Essen. Von einem Kulturland wie Österreich hätte er sich solche Zustände nicht vorstellen können, sagt Mohammed, aber er beeilt sich zu sagen, dass es in Krumpendorf um Welten besser sei. Und dann sagt er: „Als Syrien Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon aufnahm, musste kein einziger Mensch in einem Zelt oder gar auf dem Boden schlafen. Obwohl wir selber nicht reich waren. Alle haben zusammengehalten und dafür gesorgt, dass jeder Flüchtling einen Platz in einem Haus hatte. Weil es Menschen sind und ein Mensch hat das Recht auf eine menschenwürdige Behandlung“. Ich höre zu und fühle mich als Bürger des viert reichsten Landes der Welt beschämt. Nach einigen Wochen verlegt man Mohammed von Traiskirchen nach Krumpendorf. Hier gefällt ihm nicht nur die Behandlung durch die Behörden besser, sondern auch Land und Leute. „Ich lebe zwar immer noch in einem Lager, aber ich habe hier erstmals wieder Leute getroffen, die mich herzlich aufnahmen und mich sogar als Freund akzeptierten. Du weißt gar nicht, wie wichtig das ist, wenn einen einer einfach mal auf einen Kaffee einlädt, mit einem redet, einen anlächelt. Das kostet alles nicht viel Geld, aber du fühlst dich wenigstens für eine kurze Zeit wieder wie ein Mensch unter Menschen“.
Europas Fanatiker-Export
Unsere Kaffeetassen sind fast leer. Ich frage Mohammed, was wir, also der Westen, eigentlich tun können seiner Meinung nach. „Ihr müsst zuerst verstehen, dass nicht die Flüchtlinge das Problem sind, sondern der Krieg. Ohne Krieg keine Flüchtlinge. Aber ihr tut nichts, um diesen Krieg zu beenden. Ihr hättet die Revolution gegen Assad unterstützen müssen statt den Diktator ungestraft alles machen zu lassen. Sogar Chemiewaffen hat er eingesetzt. Und bitte hört damit auf, uns eure islamischen Fanatiker zu schicken. Der sogenannte Islamische Staat besteht fast nur aus Ausländern, von denen viele aus dem Westen kommen. Die kommen zu uns und nehmen uns unsere Heimat weg, führen die Barbarei ein und zerstören alles. Ihr müsst die bei euch bekämpfen statt sie zu uns kommen zu lassen“. Und worauf hoffe er, frage ich noch. „Dass ich den Asylstatus und damit Papiere kriege, damit ich meine Familie, die in die Türkei fliehen will, in Istanbul besuchen kann“. Er sei nicht nach Österreich gekommen, um hier von der Großherzigkeit der Menschen zu leben. Er wolle arbeiten und sein Studium abschließen. Und wenn der Krieg vorbei ist, werde er wieder nachhause gehen. Wir bezahlen die Rechnung und gehen unserer Wege. Ich in meine Wohnung, die mir heute vorkommt wie ein Luxusschloss, und Mohammed zurück ins Krumpendorfer Zeltlager. Vor allem eines werde ich nicht vergessen: Dass Mohammed nämlich ein ganz normaler junger Mann wäre, wenn man ihn lassen würde, wenn es nicht Krieg in seinem Land gäbe und er kein Flüchtling wäre. Als ich ihm nachschaue, wünsche ich mir, dass er doch noch mal Wien zu sehen bekommt und dass es wenigstens ansatzweise für ihn so sein möge, wie es in den arabischen Liedern beschrieben wird.