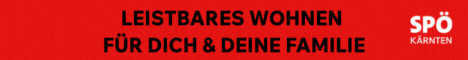1. Lockdown am 16. März 2020: Vor 5 Jahren stand Klagenfurt still
1. Lockdown am 16. März 2020: Vor 5 Jahren stand Klagenfurt still
1. Lockdown am 16. März 2020: Vor 5 Jahren stand Klagenfurt still
Heute vor 5 Jahren wurde in Österreich der erste Lockdown verhängt. Der 16. März 2020 war kein Montag wie sonst. Österreich wurde zugesperrt, das öffentliche Leben heruntergefahren. Angst und Corona übernahmen die Herrschaft über unser Leben.
Rückblickend betrachtet, wurden sicherlich Fehler im Umgang mit Corona gemacht. Manche Verhaltensregeln und Maßnahmen waren widersprüchlich und teils absurd. Man muss den Verantwortlichen jedoch zugutehalten, dass dies eine noch nie dagewesene Situation war. Oftmals führte die schiere Überforderung im Umgang mit der Pandemie zu Entscheidungen, denen die Menschen mit der Zeit nicht mehr folgen konnten oder wollten.
Die Welt hat sich seit damals verändert. Noch heute desinfizieren viele ihre Hände nach dem Berühren von Einkaufswagen, die Jugend feiert nicht mehr so viel in Lokalen wie vor Corona – und man hat längst vergessen, was 2-G, 2-G+ oder 3-G bedeutet. Hoffentlich müssen wir es auch nie wieder wissen. Die 3-G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) wurde später zur 2-G-Regel (nur noch geimpft oder genesen) verschärft, wodurch Ungeimpfte von vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen wurden. Gleichzeitig wurde das Tragen von FFP2-Masken in vielen Bereichen zur Pflicht, um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen. Der Zugang zu Restaurants, Veranstaltungen – falls diese überhaupt stattfanden – und sogar zum Arbeitsplatz war plötzlich an ein Zertifikat geknüpft.
Heute, fünf Jahre, zahlreiche Tests, mehrere Impfungen und vier Lockdowns später, blicken wir zurück auf jenen Tag, an dem die Welt, wie wir sie kannten, plötzlich stillstand. Die Covid-19-Pandemie zwang die damalige Regierung dazu, Österreich herunterzufahren und einen totalen Lockdown zu verhängen.
Wer erinnert sich nicht an die Bilder aus Bergamo (Italien), wo das Militär lkw-weise Särge mit Corona-Toten zu Krematorien transportierte? Der damalige Bundeskanzler legte nach und sprach von 100.000(en) Toten, von denen bald jeder in Österreich einen kennen werde. Auch wenn es viel Unsicherheit gab, waren sich alle sicher: Da kommt etwas ganz Arges auf uns zu – eine neue, bedrohliche Krankheit.
Es wurden Abstandsregeln definiert, Baby-Elefanten strapaziert, Strafen angedroht und ausgestellt, wenn sich jemand nicht an die verordneten Regeln hielt. Die Menschen nahmen die Situation ernst und hielten sich an die Maßnahmen. Alle hatten Angst, niemand wollte sich oder gar Familienmitglieder anstecken. Auch die Maskenpflicht wurde eingeführt, zunächst als Empfehlung, später als verpflichtende Maßnahme in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Bereichen des Alltags.
Mit der Zeit wurden PCR-Tests und Antigen-Tests zum täglichen Begleiter vieler Menschen. Um Zutritt zu Arbeitsplätzen, Gastronomie oder Veranstaltungen zu erhalten, mussten oft mehrmals pro Woche Tests absolviert werden. Auch in Klagenfurt standen die Menschen stundenlang vor Testcontainern an, um rechtzeitig ein gültiges Testergebnis zu erhalten. Die Schlangen vor den Teststationen wurden zu einem alltäglichen Bild, das den enormen Druck auf die Bevölkerung verdeutlichte.
Fenstersänger versprühten in einer Zeit voller Angst, Unsicherheit und Isolation ein Gefühl von Zuversicht und Zusammenhalt. Gemeinsam wurde der Musik gelauscht, mitgesungen und applaudiert. Die Polizei fuhr durch Klagenfurter Siedlungen und spielte über die Lautsprecher ihrer Autos "I am from Austria". Hoffnung wurde auf unterschiedlichste Weise vermittelt. Die Leute machten mit, weil sie überzeugt waren: Egal was kommt, es bleibt keiner zurück – "koste es, was es wolle" hieß es doch.
Erste Lockerungen gab es ab Mitte April 2020. Die schrittweise Öffnung von Geschäften begann, und am 1. Mai 2020 wurden die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Versammlungen mit bis zu zehn Personen waren wieder erlaubt.
Der Frühling kam, der Sommer näherte sich, und alle dachten, der Albtraum sei vorbei. Doch weit gefehlt. Der Herbst zog ins Land, die Corona-Zahlen stiegen wieder, und erste Maßnahmen wurden gesetzt, die in einen Teil-Lockdown ab dem 3. November 2020 mündeten. Der zweite harte Lockdown folgte am 17. November 2020. Mitte Dezember 2020 gab es Lockerungen – das Weihnachtsgeschäft sollte nicht völlig zum Erliegen kommen. Doch am 26. Dezember 2020, zu Weihnachten, folgte der dritte Lockdown, der bis zum 8. Februar 2021 andauerte. Danach erfolgten schrittweise Öffnungen von Handel und Schulen.
Die Stimmung kippt
Wie war inzwischen die Stimmung in der Bevölkerung, die sich im ersten Lockdown noch weitgehend an die verordneten Maßnahmen hielt? Kurz gesagt: miserabel.
Warum? Niemand sang mehr aus dem Fenster. Aus den Lautsprechern der Polizeiautos ertönte nicht mehr "I am from Austria". Die Hoffnung war verschwunden, die Stimmung kippte. Es herrschte Lockdown-Müdigkeit. Politikern, Behörden, Medien und Wissenschaftlern wurde immer weniger Glauben geschenkt. Angesichts der widersprüchlichen Aussagen im Laufe der Pandemie war das auch nicht verwunderlich.
Mittlerweile kannte jeder jemanden, der sich nicht mehr auskannte. Und jeder kannte jemanden, der pleite oder arbeitslos war oder vor dem Ruin stand. Familienmitglieder durften nicht mehr in Krankenhäusern, Pflege- oder Altersheimen besucht werden. Nahestehende Menschen durfte man nicht mehr treffen, umarmen oder beim Sterben begleiten. Die Möglichkeit der Online-Kommunikation war nur ein schwacher Trost.
Zunahme von Verzweiflungstaten
Es häuften sich die Meldungen über geöffnete Lokale, Fitnesscenter, Gaststätten etc. Längst nicht alle Betreiber waren Corona-Leugner, Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker. Viele standen schlicht vor den Trümmern ihres Lebens. Finanzielle Hilfen kamen oft nur schleppend, zu spät oder gar nicht an. Oft waren illegale Öffnungen nichts anderes als Verzweiflungstaten von Menschen, die sich im Stich gelassen fühlten oder tatsächlich im Stich gelassen wurden.
Danach gab es keine weiteren landesweiten Lockdowns. Und hoffen wir, dass NIE mehr einer kommen möge.
Doch eines ist klar: Es wurden viele Fehler gemacht, und der Vertrauensverlust, der daraus entstand, hält bis heute an. Vertrauen ist jedoch die Grundlage jeder funktionierenden Gesellschaft. Nun liegt es an Politik, Wissenschaft und Medien, dieses Vertrauen wiederherzustellen – durch Transparenz, Ehrlichkeit und den Willen, aus der Vergangenheit zu lernen. Nur so können wir gemeinsam gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen und für zukünftige Krisen besser gerüstet sein.
Fotos und Video: Mein Klagenfurt